Die Calmann-Lévy-Koedition
Entdecken Sie die neuesten Werke der Sammlung Mémorial de la Shoah, die bei Calmann-Lévy veröffentlicht wurden und in der Librairie du Mémorial oder im Online-Buchladen erhältlich sind.
Treblinka, 1942 - 1943: eine Fabrik zur Produktion jüdischer Toter im polnischen Wald von Michal Hausser-Gans
Auschwitz war nichts [nach Treblinka], Auschwitz war ein Ferienlager."
So sprach Hershl Sperling, einer der ganz wenigen Überlebenden des furchterregendsten Tötungszentrums der Aktion Reinhard. Sein Kommentar mag dem wenig informierten Leser der Realität von Treblinka als Sakrileg erscheinen. Tatsächlich ist zwar der Name dieser Stätte bekannt, aber ihre Geschichte, wie die von Belzec und Sobibor, ist viel weniger bekannt, da die Nazis große Sorgfalt darauf verwendet haben, die Spuren ihres barbarischen Unternehmens zu beseitigen, die letzten Zeugen zu liquidieren und die Überreste, die sie zurückließen, zu vernichten. Daher die Herausforderung, die diese "Unverantwortlichkeit" darstellt." Bereits 1943 hatte der Standort Treblinka das Aussehen eines landwirtschaftlichen Betriebs angenommen.
Letzter Halt eines von Berlin aus gezeichneten schwarzen Weges, Treblinka, unter allen Tötungszentren, übertraf Auschwitz in seiner Effizienz. Dort war die Vernichtung der Juden am "beschleunigtesten": fast eine Million Menschen wurden innerhalb von 400 Tagen ermordet. Gestützt auf unveröffentlichte Quellen beschreibt Michal Hausser Gans seit seiner Entstehung im Detail die Funktionsweise des Lagers und hebt die Veränderungen hervor, die zur Perfektionierung der Todesmaschine durchgeführt wurden. Bis zur Revolte vom 2. August 1943, die von einigen der Überlebenden berichtet wurde, denen es wider Erwarten gelang, die Maschine dieses untragbaren Modells der völkermörderischen Industrie zu greifen. Diese umfassende Studie ermöglicht es erstmals, einer breiten Öffentlichkeit die Auseinandersetzung mit dem "Schlimmsten des Schlimmsten" und mit diesem Weg zum Horror zugänglich zu machen, den Europa so lange nicht entschlüsseln konnte.
Kein Recht, nirgends: Breslauer Tagebuch 1933 - 1941 von Willy Cohn
 Der Historiker Willy Cohn ist eine der wichtigsten intellektuellen Figuren des jüdischen Breslau in der Zwischenkriegszeit. Besorgt über den Lauf der Dinge seit dem Aufstieg Hitlers, macht sich Willy Cohn für seine Nachkommen wie für die Nachwelt im weiteren Sinne zum Chronisten des Schicksals der Juden und des Judentums vor dem, was er als das Ende einer Welt zu betrachten scheint - seiner eigenen und der seiner eigenen.
Der Historiker Willy Cohn ist eine der wichtigsten intellektuellen Figuren des jüdischen Breslau in der Zwischenkriegszeit. Besorgt über den Lauf der Dinge seit dem Aufstieg Hitlers, macht sich Willy Cohn für seine Nachkommen wie für die Nachwelt im weiteren Sinne zum Chronisten des Schicksals der Juden und des Judentums vor dem, was er als das Ende einer Welt zu betrachten scheint - seiner eigenen und der seiner eigenen.
Er widmete also bis in die letzten Stunden vor seiner Deportation seine ganze Kraft dem Schreiben und sorgte dafür, dass ein außergewöhnliches Zeugnis an einen sicheren Ort gebracht wurde. Er tut es als Historiker, der die Einschränkungen der Rechte, die Plünderungen, die Entbehrungen aufzeichnet; als deutscher Jude, der sich verzweifelt für das Deutschland einsetzt, für das er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat; als frommer Mann, der an die Kraft der jüdischen Geschichte glaubt. Er berichtet von den Widersprüchen, die ihn bedrohen, von seinen Zweifeln darüber, wie er sich verhalten soll: fliehen oder nicht, was in Palästina zu tun? Er hatte weder die Zeit noch die Mittel, zu fliehen und wurde zusammen mit seiner zweiten Frau und ihren beiden Töchtern in Kaunas in Litauen ermordet, während seine erste Frau in Auschwitz vergast wurde.
Mit dieser verkürzten Fassung liefert uns das hier vorgestellte Breslauer Tagebuch ein wertvolles Dokument, das die deutsche Presse mit der Zeugenaussage von Victor Klemperer verglichen hat und das bei seiner Veröffentlichung große Wirkung hatte. Er lässt uns exemplarisch das Ausmaß der geplanten Vernichtung der Juden in Europa unter dem Nationalsozialismus erfassen.
Willy Cohn wurde 1888 in der damaligen Reichsstadt Breslau (heute Wroclaw, Polen) geboren. Er lehrte Geschichte am Gymnasium und forschte über die Geschichte Siziliens in der normannischen Zeit. Seine Werke sind bis heute eine Referenz. Politisch engagiert schrieb er unter anderem Biografien über Marx, Engels und Lassalle und verfasste Artikel zur jüdischen Geschichte. Er hinterließ auch Memoiren.
"VICHY, DIE FRANZOSEN UND DIE SHOAH - EIN STAND DES WISSENSCHAFTLICHEN WISSENS"
(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 212, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2020)
 unter der Leitung von Laurent Joly (CNRS)
unter der Leitung von Laurent Joly (CNRS)
Für ihre zweite Ausgabe, die vom neuen Redaktionskomitee unter der Leitung von Audrey Kichelewski und Jean-Marc Dreyfus herausgegeben wurde, zeugt RHS - Revue d'histoire de la Shoah, die älteste wissenschaftliche Zeitschrift zu diesem Thema, von der Vitalität und dem Reichtum der internationalen Forschung zur Shoah. Im Jahr 1945, angesichts der Säuberungen, hatten die Führer von Vichy, Pétain und Laval ihre Politik gegen die Juden begründet: Vichy vermied den französischen Juden das Schicksal der polnischen Juden; seine Politik war vom Wunsch geleitet, die französischen Juden zu schützen. Es ging darum, die ausländischen Juden zu opfern, um den Wechsel zu geben; und dank dieser Politik überlebte die Mehrheit der Juden in Frankreich...
Oneg Shabbès, Zeitung des Warschauer Ghettos von Emanuel Ringelblum
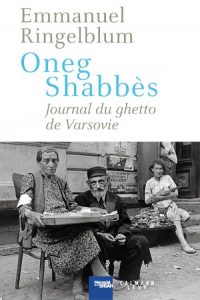 (Aus dem Jiddischen übersetzt von Nathan Weinstock und Isabelle Rozenbaumas)
(Aus dem Jiddischen übersetzt von Nathan Weinstock und Isabelle Rozenbaumas)
Emanuel Ringelblum und einige Juden aus dem Warschauer Ghetto gründen ein Team zur Sammlung von Informationen und Dokumenten, das sich jeden Samstag unter dem NamenOneg Shabbat (Oneg Shabbès auf Jiddisch), "die Freude des Sabbats". Gleichzeitig führt Ringelblum ein Tagebuch, das auf Jiddisch verfasst ist. Im Laufe der Monate gewinnt die Beschreibung des von den Deutschen organisierten schrecklichen Elends an Bedeutung. Es drängt sich auch die Beschreibung (und der kalte Zorn, der sie begleitet) des Verrats eines Teils der herrschenden jüdischen Klassen auf, der Niedrigkeit vieler, des Verrats einer Handvoll. Aber der Autor hebt auch die Solidarität und die Lebendigkeit des kulturellen Widerstands gegen dieses Martyrium hervor. Die vorliegende Übersetzung dieses bei der Befreiung gefundenen Manuskripts enthält die gesamten täglichen Chroniken von Ringelblum.
 Tagebuch 1943-1944 von Leïb Rochman
Tagebuch 1943-1944 von Leïb Rochman
(Aus dem Jiddischen übersetzt von Isabelle Rozenbaumas, Verlag Calmann-Lévy/Sammlung Mémorial de la Shoah, Februar 2017)
Leïb Rochman (1918-1978), der Autor des Meisterwerks À pas aveugles de par le monde, schreibt sein Tagebuch zwischen 1943 und 1944, als er sich mit seiner Frau, seiner Schwägerin und zwei Freunden hinter einer doppelten Wand auf dem Bauernhof einer polnischen Bäuerin versteckt, dann in eine Grube gegraben in einem Stall. Leïb Rochman und seine Gefährten hören die Außenwelt, insbesondere die Gespräche ihres Gastgebers mit benachbarten Dorfbewohnern, die beklagen, keine Juden mehr zu finden, die sie im Austausch für ein paar Kilo Zucker zum Tode liefern könnten. Neben seiner literarischen Schönheit ist dieses Zeugnis eines der eindrucksvollsten Berichte über die Shoah auf dem polnischen Land.
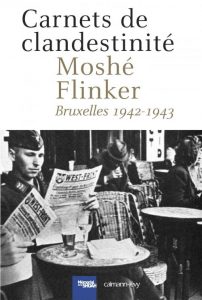 Tagebuch der Untertänigkeit - Brüssel, 1942-1943 von Moshé Flinker
Tagebuch der Untertänigkeit - Brüssel, 1942-1943 von Moshé Flinker
(Aus dem Hebräischen übersetzt von Guy Alain Sitbon, Verlag Calmann-Lévy/Sammlung Mémorial de la Shoah, Februar 2017)
Im Alter von 16 Jahren verließ Moshe Flinker mit seinen Eltern und sechs Geschwistern die Niederlande, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. In Brüssel angekommen, begann er sein Tagebuch auf Hebräisch zu schreiben. Als tiefer Kenner der jüdischen Geschichte und mit einem tiefen Glauben sind seine Schriften von der Überzeugung beseelt, dass die Schaffung eines jüdischen Staates auf dem angestammten Land die einzig mögliche Antwort auf einen in der Geschichte einmaligen Versuch der Vernichtung ist. Sein Tagebuch endet am 19. Mai 1943 mit den Worten: "Ich habe das Gefühl, tot zu sein. Hier bin ich." Am 19. Mai 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert und verschwand im Januar 1945 in Bergen-Belsen.

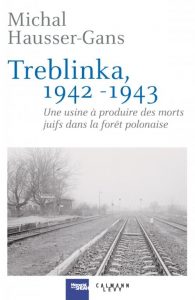


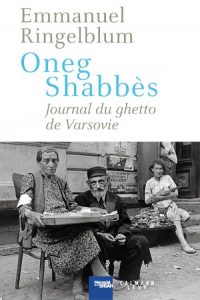 (Aus dem Jiddischen übersetzt von Nathan Weinstock und Isabelle Rozenbaumas)
(Aus dem Jiddischen übersetzt von Nathan Weinstock und Isabelle Rozenbaumas) Tagebuch 1943-1944
Tagebuch 1943-1944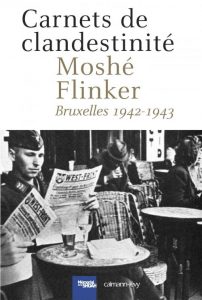 Tagebuch der Untertänigkeit - Brüssel, 1942-1943
Tagebuch der Untertänigkeit - Brüssel, 1942-1943