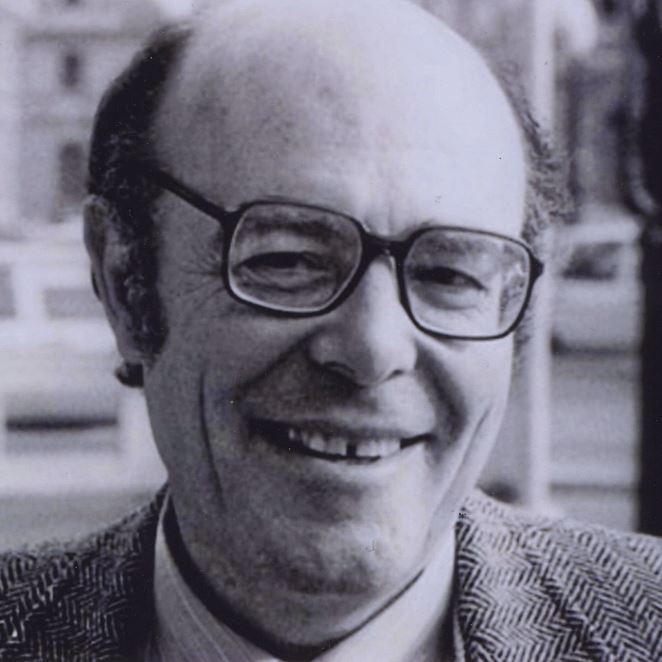Marcel Ophuls
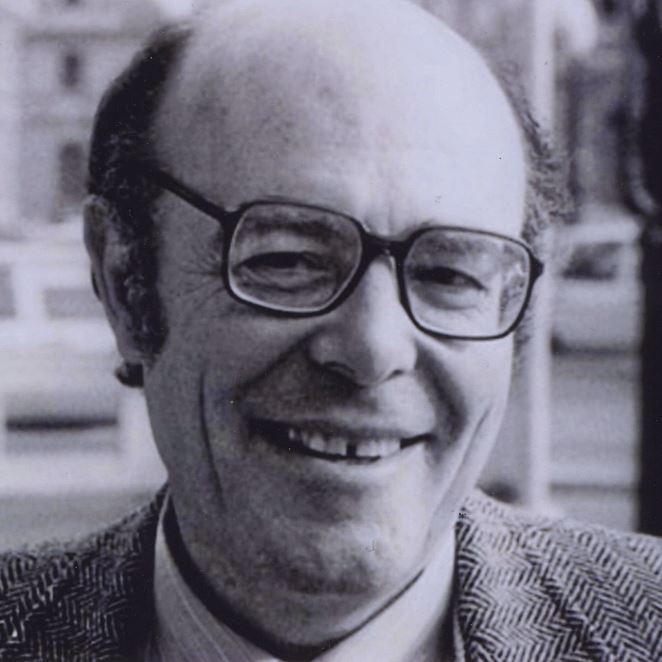
Privatsammlung Marcel Ophuls.
Geboren 1927 in Frankfurt französisch-amerikanische Staatsangehörigkeit, Marcel Ophuls ist einer der wenigen Filmemacher, deren Werke den kollektiven Blick auf das XX revolutioniert habene Jahrhundert: sein Film Kummer und Mitleid ermöglichte eine vollständige Überarbeitung unserer Wahrnehmung von die Besetzung und allgemeiner hat den Weg für eine kritische Sicht auf die zeitgenössische Geschichte durch eine pluralistische und dialektische Schrift geebnet. Außerdem keiner der großen Filme über die Shoah, beginnend mit dem von Claude Lanzmann, wären nicht möglich gewesen, wenn Marcel Ophuls hatte zuvor die Bedingungen für eine performative Nutzung des dokumentarischen Films formuliert, indem das Interview als Operateur einer Gedächtnisgeschichte genutzt wurde, um die Jagd auf den Bildschirmen sichtbar zu machen Zeugen und die Klärung der Verantwortlichkeiten. Ophuls hat die Nutzung der Archiv und historische Dokumente, mit einer Kunst des Collages, die weniger an Godard erinnert als an die Monty Python. Und er hat das Genre der Dokumentarfilm der Untersuchung, indem man aus allen Stücken ein Kino Entmystifizierer, dem Michael Moore und die unabhängigen Medien von heute alles verdanken.
Doch nichts war dem Sohn des großen Max Ophuls bestimmt, ihn mit der zeitgenössischen Geschichte zu beschäftigen. Weil er 1933 aus Berlin und 1941 aus Paris in den Koffern seines Vaters geflohen ist, weil er in Hollywood aufgewachsen ist und während seines Militärdienstes Japan besetzt gehalten hat, weil er im Grunde genommen die Tragik der Geschichte und die Qualen des Exils zu gut kennt, Dieser Lubitsch-Bewunderer strebte zunächst nur nach einer Sache: unprätentiöse Komödien zu schaffen. Trotz des Erfolgs von Peau de banane (1963) musste er sich den Produzenten André Harris und Alain de Sédouy bei der ORTF anschließen, um das Magazin Zoom zu erstellen, dessen duftende Debatten das Frankreich vor 68 faszinierten. Der Erfolg ist so groß, dass die Leitung des Senders das Zoom-Team bittet, historische Abende zu planen: Sie stellen sich zwei Abende vor, die der Sudetenkrise (München 1938 oder 100 Jahre Frieden) gewidmet sind. Der beißende und respektlose Ton, den sie verwenden, prägt die Geister, so dass man das Trio bittet, "die Fortsetzung" zu produzieren: So beginnen die Dreharbeiten, die zum Kummer und Mitleid führen sollten. Aber Ophuls, Harris und de Sédouy nahmen an den Streiks im Mai und Juni 68 teil und wurden daher aus der ORTF entlassen. Sie finalisieren den Film von der Schweiz und Deutschland aus, wo sie später arbeiten. Die ORTF weigert sich, Le Chagrin et la pitié zu finanzieren und auszustrahlen. Das Werk wurde 1969 fertiggestellt, kam aber erst 1971 in den Kinos heraus, mit enormer Wirkung.
Diese Ereignisse stürzten Marcel Ophuls in ein Leben des Wanderns zwischen Deutschland und den USA: Er arbeitete hauptsächlich für den NDR in Hamburg und lehrte häufig an amerikanischen Universitäten, wo sein Film sehr bekannt war. Denn im französischen Giscard-Frankreich ist er Opfer einer Art Ächtung, zumal er sich vor Gericht stellt, um die Rechte des Chagrins und des Mitleids an Harris und Sédouy zurückzugewinnen, die sich als Ko-Regisseure des Films ausgeben: Er wird den Sieg davontragen. Während dieser Zeit drehte Ophuls nach Gelegenheit Dokumentarfilme, die ihn unweigerlich in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückführten. Aber er bekräftigt jedes Mal die Kraft seines Blicks, seinen innovativen Stil und seine Hochschätzung, insbesondere durch die beiden Monumente: The Memory of Justice (L'Empreinte de la Justice) im Jahr 1976 und Hôtel Terminus - Klaus Barbie, sa vie et son temps im Jahr 1988. Weniger bekannt als Der Kummer und das Mitleid, ergänzen und vertiefen diese beiden Meisterwerke den Coup de Maître von 1971, indem sie die Wirrwarren der kollektiven Verantwortung und die zurückgezogenen Ängste erforschen, die zum Untergang Europas führten. sowie die fragwürdigen Kompromisse, die seinen Wiederaufbau ermöglichten.
Kummer und Mitleid
Dieser Film wurde zwischen Paris, Lausanne und Hamburg gedreht, koproduziert vom deutschen Sender Norddeutscher Rundfunk, dem Fernsehen der Westschweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Rundfunk und dem Fernsehen Rencontre (Lausanne), die damals André Harris und Alain de Sédouy beschäftigt. Die ORTF weigert sich, finanziell zu unterstützen und daher Le Chagrin et la pitié im französischen Fernsehen zu zeigen: Simone Veil, junge Richterin, Mitglied des Verwaltungsrats des Amtes und ehemalige Deportierte, hat es zu einem persönlichen Kampf gemacht, da sie der Meinung ist, dass dieser Film "nach Frankreich spukt". Wir sind noch weit von der reparativen Zeit der Gerechten entfernt... Angesichts dieser Feindseligkeit glauben Harris und Sédouy nicht, dass der Film in die Kinos kommen kann. Aber Ophuls gelingt es, sie zu überzeugen, indem er seinen Freund François Truffaut hinzuzieht. Vincent Malle und Claude Nedjar erhalten das Operationsvisum in den Kinos: es wird 20 Wochen lang im Programm stehen. Wenn der Film bereits im September 1969 im Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland, dann in der Schweiz und bei der BBC ausgestrahlt wurde, musste man bis zur Ausstrahlung im französischen Fernsehen (Oktober 1981) warten. Im Nachhinein stellt man fest, dass Ophuls die Kollaborateure nicht besonders auf Kosten der Widerstandskämpfer bevorzugt: Die Konstruktion des Films ist in dieser Hinsicht eher ausgewogen. Laut dem Historiker Henry Rousso (Le Syndrome de Vichy, 1987) war der Film ein riesiges Unterfangen einer freiwilligen und bewussten Entmystifizierung. Er bewegt die Kamera und beleuchtet die Schattenbereiche, verdunkelt aber gleichzeitig das, was überbelichtet war. Daher besteht die Gefahr, eine Legende durch eine andere zu ersetzen, was tatsächlich passiert ist: Nach dem Bild eines einstimmigen Frankreichs in der Résistance hat sich (fälschlicherweise, aber man kann es heute ruhig sagen) das Bild eines ebenso einstimmigen Frankreichs in der Feigheit ersetzt. Man kann diese voreingenommene Entmystifizierung anfechten und anprangern, und der Film wurde gerade deshalb belastet, weil er sie ohne zu zögern unternommen hat. Aber im Nachhinein zerfällt die Kritik ein wenig. Le Chagrin wollte ein Film über die Besatzung sein, er hat nie behauptet, innerhalb weniger Stunden die ganze komplexe Realität der damaligen Zeit darzustellen, auch wenn man ihn nachträglich als unfreiwillige Ehrung darum gebeten hatte. Und paradoxerweise waren es seine Mängel, die Fragen und die Debatten, die sie ausgelöst haben, die den Film zu einer wichtigen Referenz gemacht haben, auch unter Historikern."
München 1938 oder 100-jähriger Frieden
Mitte der 60er Jahre begann das ORTF, sich für historische Sendungen zu begeistern, insbesondere nach dem erfolgreichen Film Die Machtübernahme durch Ludwig XIV. von Roberto Rossellini. Neben der Serie von Jean Chérasse Présence du passé ist auch Histoire de votre temps (Geschichte aus eurer Zeit) zu erwähnen, eine schwere Retrospektive, die von Roger Stéphane und Roland Darbois durchgeführt wurde und die Geschichte Frankreichs seit der Befreiung mit großer Unterwerfung unter die gaullistische Geschichtsschreibung schildert. Der Direktor des zweiten Senders, Claude Contamine, bittet André Harris, eine Sendung über die Münchner Konferenz zu produzieren. Ophuls erfindet seinen Stil: Abwechselnd Interviews (mit Elan, Beharrlichkeit und einer gewissen falschen Offenheit geführt), Archivaufnahmen (es ist das erste Mal, dass Adolf Hitler synchron im französischen Fernsehen erscheint) und Filmausschnitte aus dem kulturellen Erbe. (hier spricht Fred Astaire in einem Film von George Stevens über die Sorglosigkeit der Londoner gegenüber dem Nationalsozialismus). Charles Trenet nimmt in München 1938 oder der Frieden für 100 Jahre den Platz ein, den Maurice Chevalier in Le Chagrin et la pitié einnehmen wird: ein Tonhintergrund als ironischer Kontrapunkt. Es ist nicht Edouard Daladier, sondern Georges Bonnet, der den bösen Geist von Ophuls heimsucht: als der ehemalige Außenminister (der auch der geheime Urheber des Rücktritts der Franzosen in München ist) mitten im Film mit Aplomb erklärt: Was sicher ist, müssen Sie nur die Fotografien aus dieser Zeit betrachten. Sie werden sehen, diese Fotografien sind zahlreich, dass wir ein äußerst trauriges und angespanntes Gesicht haben, dass wir nicht lächelnd, sondern ernst und besorgt sind. der Unverschämte Ophuls veranschaulicht diese Behauptung mit einem Foto, das Bonnet zeigt, wie er Daladier nach seiner Rückkehr aus München mit einem hilären Lächeln empfängt. Die Historikerin Annette Insdorf beschreibt diesen Gegeneffekt: Für Ophuls ist jede Meinung parteiisch. Seine Art, einen Plan zu durchschneiden, beruht oft auf einer fehlerhaften Technik, da er einer Aussage sofort eine Zeugenaussage oder Bilder gegenüberstellt, die das Gegenteil beweisen."
THE Memory of Justice (Das Gedächtnis der Gerechtigkeit)
Für wahre Kenner ist es das absolute Meisterwerk des Filmemachers: Ophuls behandelt die Frage der internationalen Gerechtigkeit angesichts von Massenverbrechen und Kriegsverbrechen und stellt einen Parallelen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland, dem Frankreich des Algerienkrieges und dem Amerika des Vietnamkriegs her. Es gibt zahlreiche und bedeutende Zeugen, von den Klarsfeld-Ehepaaren bis zu den Friedensstudenten in Princeton, wobei der amerikanische Staatsanwalt in Nürnberg, Telford Taylor, der wichtigste ist. Aber es erscheinen auch zwei hohe Hitlerwürdenträger, die in Nürnberg verurteilt wurden: Albert Speer und Karl Dönitz. Die Klarheit und Schärfe des Interviews mit Speer ermöglicht es dem zeitgenössischen Zuschauer insbesondere, die heimtückische Mischung aus Ritterlichkeit und absichtlicher Blindheit zu verstehen, die es der Hitlermacht trotz ihrer Bankrotte und ihrer Irrationalität ermöglichte, weiterzubestehen. Speer gesteht wiederholt, dass diese dem Hitlersystem unterwürfige Abhängigkeit ihn immer noch verfolgt. So zu seiner Aufgabe als Architekt in Germania, der tausendjährigen Hauptstadt des Reiches: Für einen jungen Mann ist es eine solche Versuchung, einzigartige Baustellen in der Geschichte der Menschheit zu erhalten, sowohl durch ihre Technik als auch durch das, was sie repräsentieren. Ich glaube, ich könnte sie nicht ablehnen, selbst wenn man sie mir heute anbieten würde. Und selbst wenn ich wüsste, dass die Auftraggeber dieser Baustellen schlecht sind. M. O.: Waren Sie ein guter Architekt? A.S. - Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Andy Warhol hat gesagt, dass er meine Arbeit sehr schätzt, aber meine eigene Meinung ist negativer. Gewalt, Unmenschlichkeit, Maßlosigkeit - all das war schon in der Architektur vorhanden, lange bevor die Juden ermordet wurden." Dieser Film stellt daher die Frage nach der kollektiven Verantwortung gegenüber der Geschichte und den politischen Verbrechen, aber auch nach der individuellen Verantwortung gegenüber der Barbarei der zeitgenössischen Welt. Das ist der Sinn der erschütternden Erklärung von Yehudi Menuhin, die den Film schließt: Heute ist die Folter international geworden, die Mittel und Methoden werden von den USA und Russland bereitgestellt und sie wird in Brasilien, in Chile praktiziert... Wir müssen das universelle Übel bekämpfen, das über Grenzen und Systeme hinausgeht. Wenn ich mit den Deutschen spreche, ist es nicht meine Aufgabe zu urteilen, es muss Richter geben, ein Gesetz und das Gesetz muss angewendet werden, aber ich bin kein Richter. Es ist immer peinlich, wenn der Richter selbst nicht unter den Handlungen leidet, die er beurteilen muss. Oder wenn er nur den Kampf gewonnen hat. Idealerweise sollte das Urteil von demjenigen kommen, der das Verbrechen begangen hat."
Hotel Terminus
Die Entstehung dieses Films geht auf die ersten Wochen des Jahres 1983 zurück, als Klaus Barbie, ehemaliger Chef der flüchtigen Gestapo von Lyon unter dem Namen Klaus Altmann, aus Bolivien nach Frankreich deportiert wurde. Die Nachrichten über einen geplanten Prozess in Frankreich enthüllen die amerikanischen Komplizen, die es der Ex-Gestopiste ermöglicht haben, nach Südamerika zu gelangen, und Ophuls wurde vom Produzenten John S. Friedman angesprochen, der ihm vorschlug, einen Film darüber zu drehen. Er beginnt, Geld zu sammeln und startet in dieses gefährliche Abenteuer ohne wirkliche Professionalität, trotz des Widerstands von Ophuls, der darin kein gutes Filmthema sieht. Für beide Männer ist der Kalender höllisch: Alles hängt von den Bildern des Barbie-Prozesses in Lyon ab, der ständig verschoben wird - so sehr, dass Friedman erwägt, eine von Schauspielern interpretierte Version davon zu drehen! Der Prozess gegen Klaus Barbie fand schließlich vom 11. Mai bis zum 4. Juli 1987 vor dem Cour d'assises du Rhône in Lyon statt. Inzwischen hat Claude Lanzmann sein Meisterwerk veröffentlicht und es ist unbestreitbar, dass das Hôtel Terminus vom Film Shoah beeinflusst wurde. Lanzmann zeigt sich übrigens in diesem Film, der wohl derjenige ist, der in der Filmographie von Ophuls die Frage der Ausrottung am stärksten thematisiert. Es ist auch derjenige, der am wenigsten Archivbilder und eine Rekordzahl von Zeugen aufweist, die auf dem Bildschirm in einem wissenschaftlichen Durcheinander auftauchen. Aber die New York Times, Vincent Canby, macht sich die paradoxe Kraft dieses organisierten Chaos sehr gut bewusst: Das Tempo der Kreuzung der Zeugen ist so, dass man manchmal die Identität dessen vergisst, der spricht. Ab einem bestimmten Stadium scheint es, dass der Filmemacher sich selbst interviewt, um die Untersuchung zu überprüfen und mit klaren Gedanken zurückzukehren. Zu anderen Zeiten hat man das Gefühl, dass er nie alles erfassen kann. Je mehr er gräbt, desto mehr findet er." Hotel Terminus erhielt 1989 den Oscar für den besten Dokumentarfilm in Los Angeles.
Ein Reisender
Testamentswerk, das zu dem Zeitpunkt erstellt wurde, als Ophuls seine Memoiren unter dem Titel Mémoires d'un fils à papa (Erinnerungen eines Sohnes für den Vater), Ein Reisender kommt in den 2010er Jahren heraus und bringt einen Hauch von Melancholie zu einem häufig autofiktionalen Werk: geschrieben nach dem Vorbild des Films von Duvivier, Carnet de Bal, Dieser Abstecher in die Vergangenheit ermöglicht es dem Filmemacher, auf seine Karriere, seine großen Leidenschaften und seine grundlegenden Freundschaften zurückzublicken, insbesondere die von François Truffaut, die zusammen mit seiner Witwe Madeleine Morgenstern erwähnt wurde... Die Geschichte des Films ist wie immer komplex: Es handelte sich ursprünglich um ein Projekt des bretonischen Regisseurs Vincent Jaglin, von dem Marcel Ophuls thematisiert wurde. Er übernahm die Leitung, Jaglin wurde sein Assistent und das Projekt wurde zu einer Art gefilmter Autobiografie. Der Produzent Frank Eskenazi erlaubte es dem Film, auf Arte zu erscheinen, trotz der Schwierigkeiten des Filmemachers, die Dauer der ursprünglichen Bestellung zu verdoppeln, da sein Freund Fred Wiseman es geschafft hatte, im selben Kontext mit dem französisch-deutschen Sender zusammenzuarbeiten. Der Film wurde 2013 zur Quinzaine des Réalisateurs in Cannes ausgewählt. In diesen oft zärtlichen und manchmal krummen Bekenntnissen entblößt sich Ophuls mit seinen Fehlern, Schwächen und Bedauern, und wie in den November-Tagen zollt er dem Genie seines Vaters, einer schützenden Figur, die ihm als eine Art Kompass geblieben ist, letzte Ehre. sowohl auf moralischer und künstlerischer Ebene als auch in seinen schwierigen Beziehungen zu den Produzenten. Es handelt sich um ein intimes Werk, das die Männer und Frauen ehrt, die Ophuls in seiner Karriere geholfen haben, und an die vielen verpassten Termine erinnert, die das Leben des Regisseurs geprägt haben. Es ist auch ein Film, den er Frankreich widmet, nachdem er ausführlich über Deutschland (November Days) und die Vereinigten Staaten (À la recherche de mon Amérique) gesprochen hat: Er beschreibt Frankreich als sein Herzensland. auch wenn man dies natürlich auch erkennen kann, und hier einige Anzeichen, die ein Gefühl der Enttäuschung oder Verbitterung verraten - ein Gefühl, das in der schönen Formel des Anwalts Léon-Maurice Nordmann (auf dem Mont Valérien erschossen) zusammengefasst ist, die einmal von Robert Badinter über die Juden und Frankreich erzählt wurde: Es ist die Geschichte einer Liebe, die schlecht ausgegangen ist.
Marcel Ophuls und die Historiker
Ophuls stützte sich auf die Arbeiten von Eberhard Jaeckel und Jacques Delarue, um Le chagrin et la pitié vorzubereiten, das zwei oder drei Jahre vor der Herausgabe von La France de Vichy erschien, eine Übersetzung des Buches Vichy France Old Guard and New Order 1940-1944 des amerikanischen Historikers Robert O. Paxton. Geschrieben 1972, sollte dieses Werk einen Aufschrei in den französischen Eliten hervorrufen, denn Paxton behauptet, dass der französische Staat dem deutschen Druck in absolut keinem Bereich standgehalten habe (kein doppeltes Spiel, im Gegensatz zu einer noch weit verbreiteten Ansicht im damaligen Frankreich). ; dass die Franzosen in vielen Fällen sogar die deutschen Erwartungen übertroffen haben; dass der Antisemitismus eine wesentliche und strukturierende Tatsache der von den Marschallideologen unternommenen Umgestaltung der Gesellschaft war; dass die Nationale Revolution tatsächlich eine konservative Rückeroberungsbewegung war, die sich aus der Erfahrung der Volksfront ergab. Im Grunde fand alles, was in Ophuls' Film erschien, historische Legitimität. Laut Henry Rousso: Man muss zugeben, dass das Vichy-Frankreich weitgehend vom Ophuls-Effekt und dem allgemeinen Kontext der Jahre 1971-1974 profitiert hat. Paxton, mehr vielleicht als die anderen Bücher, die zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurden, stellte trotz seiner Widersacher die wissenschaftliche Bürgschaft für die Rückkehr des Zurückgewiesenen dar. Zwei Jahre nach der turbulenten Veröffentlichung von Le Chagrin nimmt er den Anschein einer kalten und objektiven Demonstration an, warmherzig skizzierte Thesen im Film. Und wie Ophuls fürchtete er aus anderen Gründen die Provokation nicht." In Der Kummer und das Mitleid bricht Ophuls das Tabu über die Beteiligung der französischen Verwaltung an der Deportation der Juden, indem er aktuelle Bilder von Reinhard Heydrichs Besuch bei René Bousquet im Mai 1942 übernimmt. Wie Marc Ferro sagt, ist es die Oktoberrevolution des Dokumentarfilms.
Marcel Ophuls und die Shoah
Wenn Frédéric Rossif und einige andere Ophuls in der Darstellung der NS-Verbrechen, die im Wesentlichen aus antisemitischen Motiven herrührten, vorangegangen sind, hatte bisher niemandDort wurde auch kalt die Realität der kriminellen Handlungen, wie sie in Frankreich vor dem Hintergrund kollektiver Feigheit stattgefunden haben, dargelegt. Er tut dies insbesondere anlässlich seines Treffens mit Marius Klein, einem friedlichen Kaufmann aus Clermont-Ferrand, den er in seinem Geschäft in Le Chagrin et la pitié (Die Trauer und das Mitleid) kennenlernt. Er überraschte ihn und brachte ihn dazu, zuzugeben, dass er während der Besetzung eine Anzeige aufgegeben hatte, um seine Kundschaft wissen zu lassen, dass er trotz seines deutsch klingenden Namens kein Jude sei. Marius Klein begründet sich mühsam, doch seine Doppelzüngigkeit kommt ans Licht. In diesem Abschnitt hebt Ophuls die Komplizenschaft eines Teils der französischen Bevölkerung hervor, der durch das Geständnis eines seiner Mitglieder (wir waren alle gegen die Juden) symbolisch vom Status des Zuschauers zum Status des Schauspielers übergeht. Marcel Ophuls erwiderte denen, die ihm vorgeworfen haben, diesen ehrlichen Auvergne in eine Falle gelockt zu haben: Ich hielt es für meine Pflicht, den Autor dieser Ankündigung wiederzufinden, weil meine allgemeinen Vorstellungen von der Geschichte weder personalistisch noch marxistisch sind, sondern demokratisch. Ich habe eine pluralistische Sicht auf die Geschichte, das heißt, ich glaube, dass sie sowohl von großen Männern als auch von kleinen Menschen gemacht wird. (...) Dann fiel ein Blitz auf diesen Mann. Menschlich ist das eine sehr spannungsgeladene und sehr peinliche Sache: die wohltätigen Seelen werden denken, dass es ihm zu diesem Zeitpunkt an Eleganz mangelt, wenn er ihn befragt, dass ich kein Mann guter Gesellschaft bin. Ich muss sagen, dass mir die Begriffe von Eleganz und guter Gesellschaft in Bezug auf das jüdische Problem - das fast bis zu seiner endgültigen Lösung geführt wurde - restriktiv erscheinen. Dieser Mann repräsentiert meiner Meinung nach lediglich Millionen von Menschen, und ich glaube nicht, dass es demagogisch ist, ihm diese Frage zu stellen. Also wird man fragen, warum wir ihn nicht gewarnt haben? Es ist sehr einfach, denn er hätte das Interview wahrscheinlich nicht gegeben. Und es kam bei einer so wichtigen Sache nicht in Frage, sich zu schmeicheln. Übrigens hat man ihm nicht viel Schaden zugefügt, er hat trotzdem nachher seine Zustimmung gegeben, damit das Interview stattfinden kann." Der Name der Figur von Herrn Klein, dem Meisterwerk von Joseph Losey, ist aus dieser Szene entnommen.
Marcel Ophuls und Jean-Luc Godard
Die beiden Männer kennen sich seit den 1960er Jahren und bewundern einander. In den Jahren 2002/2003 schlug Jean-Luc Godard Marcel Ophuls vor, einen Film über den israelisch-palästinensischen Konflikt zu drehen. Dieses Projekt stieß auf ein Missverständnis zwischen den beiden Filmemachern. Marcel Ophuls schildert die Gründe für diese Distanz: Als Jean-Luc mit ausgezeichneten Absichten vom Ufer des Genfersees bis zum Ende des Béarn kam, um mit mir über dieses Projekt zu sprechen und ich ihn um einen Vertrag und eine Einigung über den Final Cut bat, Er hat den Charakter eines abwesenden Großbürgers angenommen, der sich nicht für Anwaltsgeschichten und Geldprobleme interessiert. Das Erste, was er mir bei der Ankunft sagt, ist: "Marcel, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich komme aus einer Kollaborationsfamilie..." Und ich weiß, dass in der Korrespondenz von François Truffaut, die nach seinem Tod erschien, als sie sehr verärgert waren, François ihm einen Brief geschrieben hat, in dem er ihn daran erinnert, dass er Pierre Braunberger einen dreckigen Juden genannt hatte... Das hat Jean-Luc nicht davon abgehalten, ein sehr schönes Vorwort zu dieser Korrespondenz zu machen. Ich hätte zugestimmt, seinen Film zu machen, wenn er Reportagen über Arafat gedreht hätte, und ich hätte mit der israelischen Linken berichtet. Und ich hätte das gerne mit Gesprächen gewürfelt, die wir im Béarn und am Ufer des Genfersees mit den kleinen Enten vom See gehabt hätten... Aber irgendwann hätte ich ihm den Brief unseres gemeinsamen Freundes zitiert. «Jean-Luc, in welcher Eigenschaft hältst du dich für kompetent, den Krieg im Nahen Osten zu beurteilen? Wenn es wahr ist, lügst du mich an, dass du Pierre Braunberger nach dem Holocaust als dreckigen Juden bezeichnet hast, nicht vor? Wenn du wirklich einen prominenten Produzenten, der Vivre sa vie, deinen schönsten Film produziert hat, als dreckigen Juden bezeichnet hast, was willst du dann bei mir machen?" Und wenn wir den Film gemacht hätten, hätte ich ihm die Frage stellen müssen, und wenn ich ihn fragen würde, müsste es im Film bleiben! "Und wer bekommt den final cut? Du oder ich?" Dennoch hegt Ophuls grenzenlose Bewunderung für den, den er mit den Worten von Truffaut als "talentiertesten unter uns" bezeichnet.
Text von Vincent Lowy, Professor für Filmwissenschaft und Direktor der École nationale supérieure Louis-Lumière. Autor insbesondere von Marcel Ophuls, Le Bord de l'eau Éditions (2008)